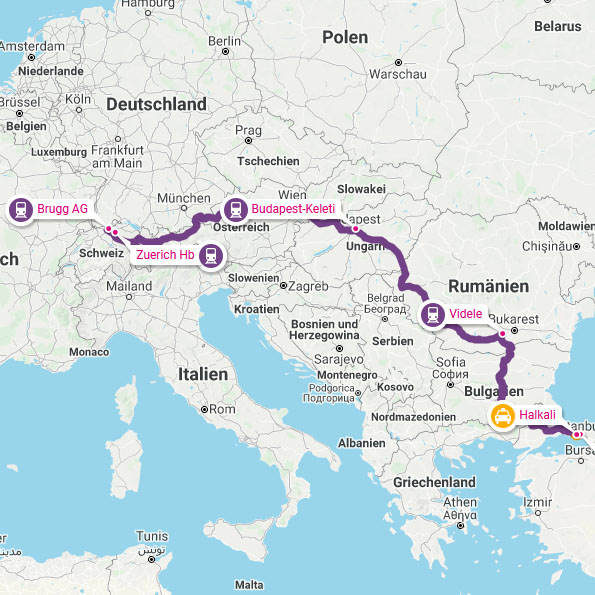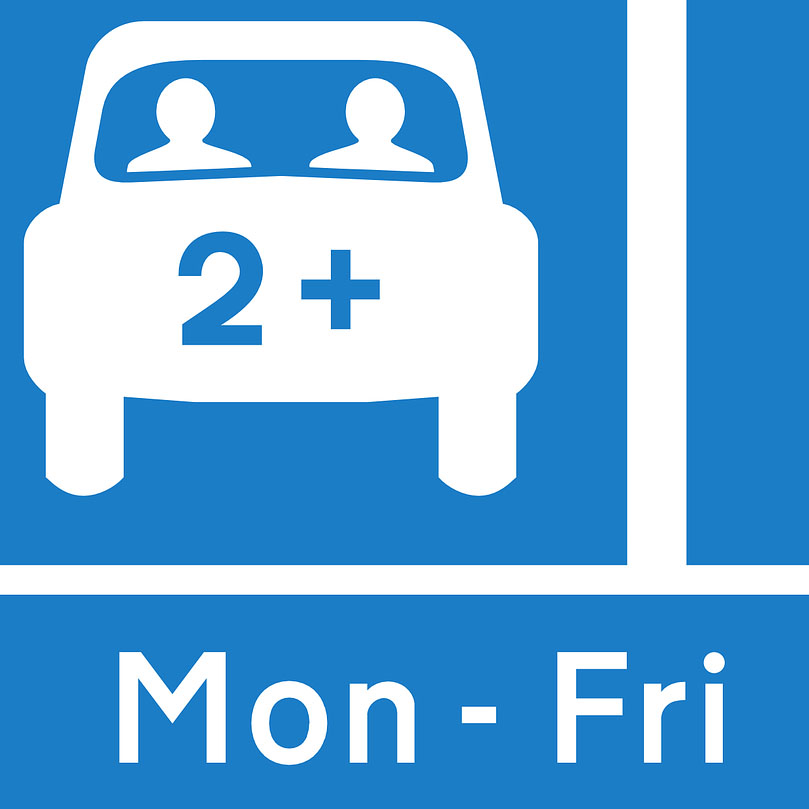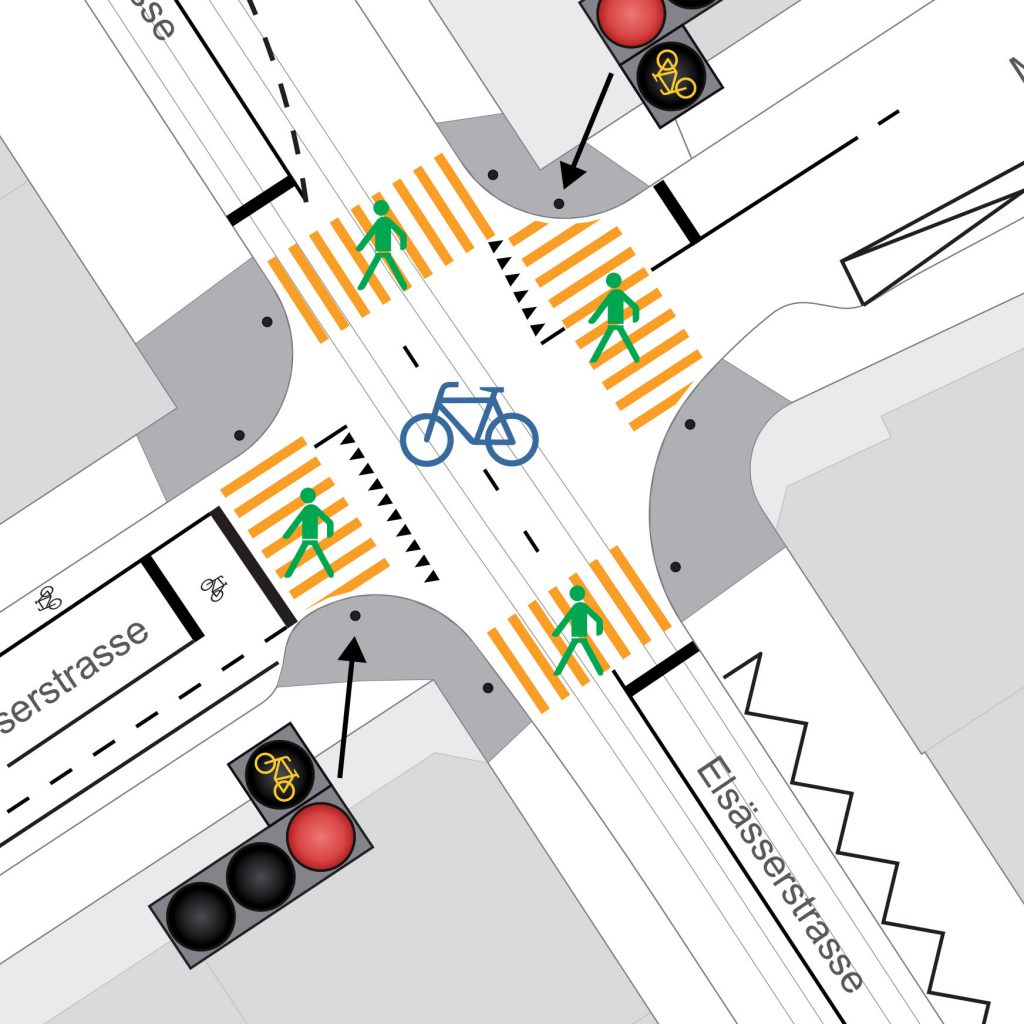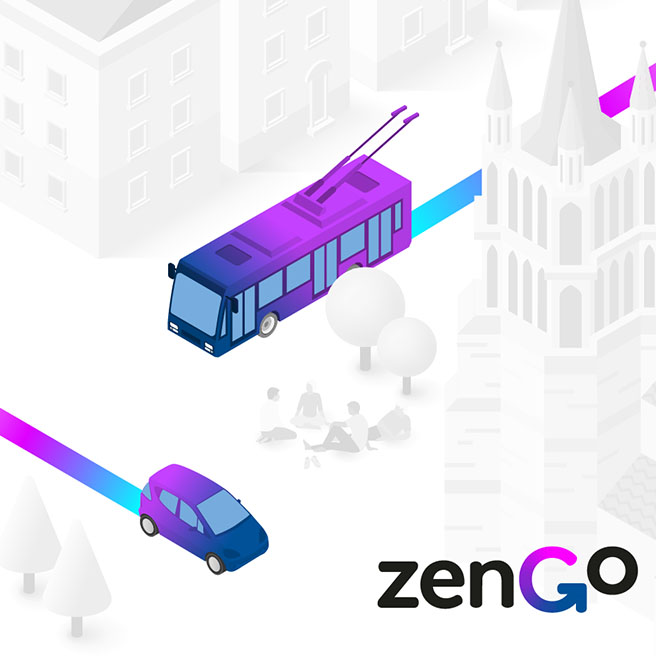Wer Fachleute fragt, was sie unter smarter Mobilität verstehen, erhält sehr vage Antworten. Der Begriff lässt vieles offen und gleicht einem glitschigen Fisch, der schwierig zu fassen ist. Wir wagen es, nach dem Fisch zu greifen, und plädieren dafür, weniger den Weg der technischen Innovation, als vielmehr das Ergebnis in den Vordergrund zu rücken.
Das Thema Smart City ist im Bereich der Mobilität omnipräsent. Die Palette an Interpretationen rund um den Begriff «smart» ist breit und wird sehr individuell ausgelegt. Im Vordergrund stehen oftmals technische Innovationen rund um die Verkehrsmittel (z. B. Automatisierung) sowie deren Verfügbarkeit und Vernetzung (z.B. «Mobility as a Service»). Trotz der Präsenz äussern sich die meisten Fachpersonen nur ungern prominent zu diesem Thema und überlassen das Feld einem kleinen, lauten Kreis von Wortführern. Einerseits ist die fachliche Fallhöhe gross; die Themenbreite und die Dynamik erschweren es, einen Überblick zu behalten. Andererseits wird man schnell in Schubladen gesteckt: entweder in die der pessimistischen Innovationsverweigerinnen oder in die der realitätsfremden Technikgläubigen.
«Wenn es [smart] vorwärts geht, fragt keiner wohin»
Kommen wir von den Schubladen zurück zur Smart City: Ob eine Lösung smart, also intelligent ist, lässt sich – frei nach Garri Kasparow – nicht am Weg, sondern nur am Ergebnis feststellen. In diesem Sinn ist es nebensächlich, ob die Lösung auf neuartigem digitalem oder eher bewährtem altmodischem Weg gefunden wird. Die Smart City-Debatte im Mobilitätsbereich dreht sich derzeit jedoch vor allem um den Weg (technische Innovationen) und weniger um das Ergebnis respektive den Beitrag zur Erreichung der Ziele. Ganz nach Klaus Klages: «Wenn es [smart] vorwärts geht, fragt keiner wohin.»
Der grosse Treiber der uferlosen verkehrlichen Auswirkungen bleibt zweifellos unser freiheitsliebendes Mobilitätsverhalten.
Doch ist das Wohin nicht bereits bekannt? In Richtplänen, Visionen und Leitbildern sind die Ziele der Verkehrswende festgelegt. Der Begriff «Verkehrswende» wurde sogar in den Duden aufgenommen. Auch über die verkehrsplanerischen Hauptherausforderungen herrscht weitgehend Einigkeit: stets gefordertes Wachstum bei erreichten Kapazitätsgrenzen, eine (wachsende) Vielzahl an Nutzungsansprüchen bei beschränkten räumlichen Verhältnissen und limitierten finanziellen Ressourcen sowie das schleichend akuter werdende und ungelöste Problem rund um das Klima .
Wenn also die Ziele und die Herausforderungen bekannt sind, warum tun wir uns mit der Umsetzung von Massnahmen so schwer? Bringen uns die neuen technologischen Ansätze hierfür eine Erleichterung – oder eher eine spielerische Ablenkung?
Die durch Digitalisierung und technischen Fortschritt ausgerufene Verkehrswende wird teilweise dazu missbraucht, unangenehmen und einschränkenden Massnahmen auszuweichen. Die Hoffnung, dass beispielsweise kürzere Autofahrten durch die Nutzung von E-Scootern ersetzt werden können, hat sich bis jetzt nicht bestätigt. Der grosse Treiber der uferlosen verkehrlichen Auswirkungen bleibt zweifellos unser freiheitsliebendes Mobilitätsverhalten, das nur schwer anzutasten ist, sich aber künftig ändern muss.
Ideen und Lösungen
Öffnet die Schubladen für eine breite Debatte!
Um eines klarzustellen: Wir sehen optimistisch in die Zukunft und sind offen für Innovation. Die Hoffnung bleibt, dass sie den Schritt zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten erleichtern wird. Neben den technologischen Entwicklungen im Mobilitätsbereich im engeren Sinn werden aber vor allem die sozialen Trends, die unsere Verhaltensmuster beeinflussen, grosse Effekte auf die Mobilität und damit auf den erzeugten Verkehr haben.
Vermehrte mutige Versuche und Pilotprojekte sind unerlässlich, um die Wirkkraft und -richtung zu testen und vorausschauend notwendige steuernde Massnahmen zu initiieren. Wir wünschen uns eine ehrlichere und breitere Diskussion der Ergebnisse solcher Projekte. Dies zu ignorieren wäre einfach, doch es steht einiges auf dem Spiel: Neue Technik hat vielleicht heute nur einen spielerischen Reiz, doch sie wird den Alltag künftiger Generationen prägen. Versuchen wir also lieber, die Richtung zu steuern. Wäre es zynisch zu behaupten, dass die innovativen Pilotprojekte zuweilen als Marketingelement für die Zurschaustellung der Innovationskraft oder zur Auslotung neuer Geschäftsmodelle genutzt werden? Nachhaltige Verkehrswende und gesellschaftliche Ziele stehen dabei wohl eher im Hintergrund.
Öffnen wir neue Schubladen für notorische Verkehrswendepocherinnen und experimentierfreudige Grünschnäbel. Mindestens diese Rollen sind im laufenden Diskurs kaum hörbar. Gerne dürfen sich weitere Stimmen anschliessen, egal aus welcher Schublade. Nehmen wir uns des glitschigen Fischs an und bringen wir uns vermehrt in die Debatte für eine zukünftige intelligente Mobilität ein. Denn der Zeitpunkt könnte nicht besser sein: «Zukunft – nie war sie so nahe wie heute» (Hubert Burda).
Matthias Oswald und Alex Stahel
Projektleiter bei der Metron Verkehrsplanung AG. Gemeinsames Studium der Raumentwicklung und Infrastruktursysteme an der ETH Zürich (Abschluss 2012), heute teilen sie sich nun auch ein Büro.